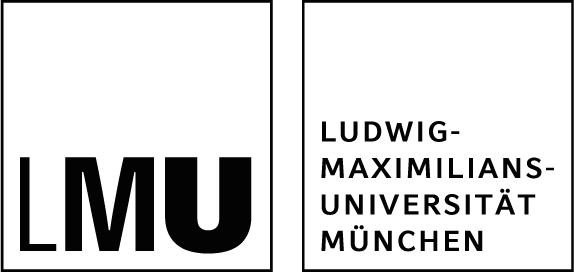Komödie
Die Komödie nach Aristoteles
In der Poetik des Aristoteles findet die Komödie nur am Rande Erwähnung. Dies dürfte damit zu tun haben, dass uns heute nur der erste Teil der aristotelischen Poetik überliefert ist, welche die Tragödie behandelt. Ein spekulativer zweiter Teil zur Komödie ist nicht zugänglich. Die Grundparameter der Komödie sind jedoch bereits im überlieferten Teil beschrieben. So stellt die Komödie ‚schlechte‘ oder ‚unterdurchschnittliche‘ Charaktere dar. Das ‚Schlechte‘ sei aber nicht als ‚Verwerfliches‘ zu verstehen, sondern als Lächerliches (τὸ γελοῖον). Gleichzeitig sei dieses Lächerliche aber nicht schädlich und verursache keine Schmerzen.[1] Auch die ‚hässlichen‘ Masken der Komödie nennt Aristoteles kurz.[2]
Die Komödie bei Horaz und in der römisch-lateinischen Tradition
Auch in der Ars poetica des Horaz wird die Komödie nicht ausführlich in einem eigenen Abschnitt besprochen. Zwar wird sie – wie die tragische Dichtung – in Zusammenhang mit dem Aptum gebracht: Eine Komödie könne nicht in tragischen Versen geschrieben werden und vice versa.[3] Doch findet sich keine explizite Theoretisierung der Komödie. Zentral ist für die spätere Zeit jedoch die wohl berühmteste Stelle der Ars poetica, diejenige des „[a]ut prodesse volunt aut delectare poetae / aut simul et iucunda et idonea dicere vitae“.[4] Gemeint ist die Aufgabe der Poesie, sowohl nutzen als auch unterhalten zu können, sodass dem Lachen ein legitimer Platz eröffnet wird. In der Theaterpraxis römisch-lateinischen Antike finden sich unterdessen zahlreiche Komödien, die in späteren Jahrhunderten Modell für andere Komödien standen. Die wichtigsten Namen sind hierbei Plautus und Terenz. So stellt die Aulularia des Plautus eine Charakterkomödie auf einen Geizigen dar – die wohl bekannteste ‚Nachfolgerkomödie‘ dürfte L’avare von Molière im 17. Jahrhundert sein. Der Bezug auf bekannte Vorgängerkomödien war aber schon in der römisch-lateinischen Antike gängige Praxis. Dass diese Praxis auch wegen vermeintlich begrenzter Innovativität bei den Zeitgenossen potentiell kritisch gesehen werden konnte, zeigt sich u.a. in den Prologen der Komödien, z.B. in dem der Heautontimorumenos des Terenz.[5]
Geschichte der Komödie in Italien: Renaissance
Während die Komödie als Theaterform im Mittelalter eine geringere fortuna aufwies, finden sich ‚klassische‘ Komödien ab dem Cinquecento in italienischer Sprache.[6] Die berühmtesten ersten italienischsprachigen Komödien sind unweigerlich mit den Namen Ariosts und Machiavellis verbunden. In diesen, wie in La Cassaria Ariosts oder in der Mandragola Machiavellis sind deutliche Bezüge zu den antiken Vorbildern zu erkennen, auch wenn keine vollumfängliche Kopie stattfindet. Eine Ausnahme stellen Übersetzungen bzw. beinahe direkte Übertragungen dar, im Falle Machiavellies ist die Andria zu nennen, welche sehr direkt die Andria des Terenz ins Italienische überträgt. Ein weiterer Name, der im Umfeld der italienischen Renaissance-Komödie zu nennen ist, ist Aretino, u.a. mit La Cortigiana.
Geschichte der Komödie in Italien : Die Reform Goldonis
Im Zusammenhang mit der Komödie ist auch die Theaterreform Goldonis zu nennen. Goldoni widersetzte sich der Praxis der Commedia dell’arte, die u.a. mit typisierten Figuren – bzw. mit deren Masken – einherging.[7] Die entsprechenden Figuren der Commedia dell’arte hatten z.B. keine festgelegten Redepartien, in den Aufführungsvorlagen finden sich lediglich Beschreibungen, was der Schauspieler oder die Schauspielerin aufführen und oft bewirken sollte. Dieser Praxis, die sich z.T. auch in den ‚märchenhaften‘ Stücken Carlo Gozzis findet, stellte Goldoni eine verstärkt ‚realistische‘ Darstellung gegenüber. Die (unmaskierten) Figuren sollten einen klaren Charakter mit eigener Identität darstellen. In diesem Zusammenhang definiert Goldoni u.a. klar vorgegebene Redepartien für die einzelnen Figuren und begrenzt so das Improvisationstheater.[8]
Ausblick: Die Filmkomödie
Während auch im Novecento die (Theater-)Komödie in ihren verschiedenen Ausprägungen u.a. mit Luigi Pirandello, Eduardo De Filippo und Dario Fo große Erfolge feierte, trat insbesondere ab den 1950er Jahren zunehmend die Filmkomödie hinzu. Zu nennen sind hierbei Verfilmungen von Theaterkomödien wie Filumena Marturano von De Filippo, aber Filmkomödien basierend auf Prosatexten wie die Filmreihe um Don Camillo e Peppone. Diese basieren größtenteils auf den Erzählungen Giovannino Guareschis. Im Laufe der Zeit traten aber auch genuine Filmkomödien auf, wichtige Namen sind hierbei v.a. Federico Fellini und Roberto Benigni. Ist die Theaterkomödie bereits ein multimediales ‚Ereignis‘, gilt dies für die Filmkomödie umso mehr. Für deren Analyse sind oft auch technische Aspekte wie Kameraeinstellung oder Schnitt von Bedeutung.[9]
Literaturnachweise
- Vgl. ARISTOTELES 1995: „Περὶ ποιητικῆς“, in: Aristotle. Poetics; Longinus. On the Sublime; Demetrius. On Style, übersetzt von Stephen Halliwell, Cambridge MA, S. 27–141, hier S. 44 (=1449a).[↩]
- Vgl. ARISTOTELES 1995: „Περὶ ποιητικῆς“, in: Aristotle. Poetics; Longinus. On the Sublime; Demetrius. On Style, übersetzt von Stephen Halliwell, Cambridge MA, S. 27–141, hier S. 44 (=1449b).[↩]
- FLACCUS, Quintus Horatius 2008: „Ars poetica“, in: Quintus Horatius Flaccus. Opera, hg. von David R. Shackleton Bailey, Berlin/Boston: De Gruyter, S. 310–329, hier: S. 314 (=89–91).[↩]
- FLACCUS, Quintus Horatius 2008: „Ars poetica“, in: Quintus Horatius Flaccus. Opera, hg. von David R. Shackleton Bailey, Berlin/Boston: De Gruyter, S. 310–329, hier: S. 323 (=333–334).[↩]
- TERENTIUS AFER, Publius 1898: „HAVTON TIMORVMENOS“, in: P. Terenti Afri comoediae, hg. von Alfred Fleckeisen, Berlin/Boston: De Gruyter, S. 51–103, hier: S. 53–54 (=PROLOGVS).[↩]
- Zur Geschichte der Komödie allgemein vgl. mit Blick auf Italien v.a. die Beiträge in FIGORILLI, Maria Cristina/VIANELLO, Daniele (Hgg.) 2018: La commedia italiana: tradizione e storia. Bari: Edizioni di pagina. Vgl. allgemein KLOTZ, Volker u. a. 2013: Komödie. Etappen ihrer Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt a. M.: S. Fischer.[↩]
- Zur Commedia dell’arte vgl. u.a. TAVIANI. Ferdinando 1969: La commedia dell’arte e la società barocca : la fascinazione del teatro, Rom: Bulzoni sowie vgl. MAROTTI, Ferruccio/ROMEI, Giovanna 1991: La commedia dell’arte e la società barocca – La professione del teatro, Rom: Bulzoni.[↩]
- Vgl. zur Theaterreform Goldonis v.a. die Vorstellungen Goldonis selbst. Diese finden sich insbesondere in der Einleitung Goldonis zum ersten Band seiner Komödien herausgegeben durch Giuseppe Bettinelli ab dem Jahr 1750. Der Text findet sich online in Form der vierten Auflage aus dem Jahr 1753, auf den Seiten 5–15: https://www.google.de/books/edition/Le_commedie_del_dottore_Carlo_Goldoni_av/rooHAAAAQAAJ.[↩]
- Zur Analyse von Filmen vgl. einführend u.a. KEUTZER, Oliver u.a. 2014: Filmanalyse, Wiesbaden: Springer. Vgl. außerdem mit Blick auf die Literaturwissenschaft und die Philologie BOHN, Anna 2020: „Filmphilologie“, in: Handbuch Filmanalyse, hg. von Malte Hagener, Volker Pantenburg, Wiesbaden: Springer, S. 195–216.[↩]